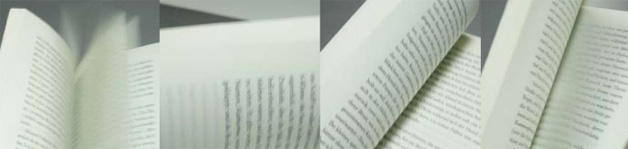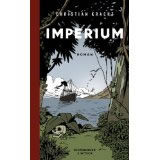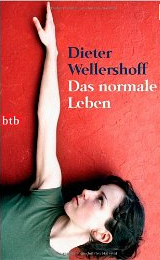|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
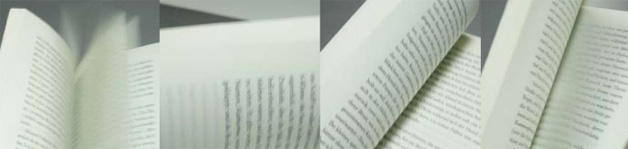 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Berliner
Literaturkreis
LESEN - DISKUTIEREN - SCHREIBEN |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
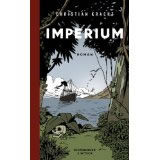 |
 |
Christian Kracht
Imperium
Witsch Verlag, Köln 2011
Meine Erwartungen an das Buch von Christian Kracht „Imperium“ waren hoch. Viele kluge Rezensenten hatten schon viel geschrieben und geredet, bevor ich das Buch aufgeschlagen habe. Von Frau Jelineks Klappentext ermuntert, erwartete ich einen Abenteuerroman. Das war er nur teilweise. Auch war er kein biografischer Roman im herkömmlichen Sinn, kein üblicher Gesellschaftsroman oder eine Gesellschaftssatire und auch nicht unbedingt ein historischer Roman. Aber mit Sicherheit war er von alledem ein bisschen oder auch an mancher Partie ein wenig mehr als ein bisschen. Insoweit waren die etwa zweihundertfünfzig Seiten schnell und gut zu lesen. Ich fühlte mich auch gut unterhalten. Was will man also mehr von einem solchen Werk? Ich wollte etwas mehr ausgeformte Personen. Da tauchten Menschen um Gustav Engelhardt auf, die einigen Einfluss auf sein reales Leben hatten, viele seiner zum Teil „eigenartigen“ Handlungen hätten beleuchten oder erklären können. Im Roman tauchten sie auf und verglühten relativ schnell bis auf seinen einheimischen Adlatus, dessen romanhafte Bedeutung aber auch immer die einer Randfigur behielt. Wohl schaffte es das Buch eine ungefähre Vorstellung über das eigenartige Dasein und Leben in einer deutschen Kolonie zu Anfang des vorigen Jahrhunderts zu entwerfen und animierte mich, in der realen Historie um den Kokovaren zu graben. Nun bleiben nur die Sprache und die Anklage, dass schädliches nazistisches oder rassistisches Gedankengut im Roman versteckt oder offen zutage träte. In der beschriebenen Zeitspanne herrschte allgemein in Europa Antisemitismus und Rassismus allerorten vor. Dies war beileibe nicht nur eine deutsche Attitüde. Insoweit ist es nicht verwunderlich, dass sich Handelnde mit derartigen Aussagen hervortaten. In keiner Zeile war erkennbar, dass sich Kracht als Autor mit diesem Gedankengut identifizierte. Im Gegenteil. Er verstand es recht gut, den Leser auch sprachlich in die Zeit vor hundert Jahren zu versetzen, obwohl seine „Schreibe“ manches Mal doch recht maniriert geriet. Viele Ausdrücke aus seiner Zeit in den USA und seinem Wohnsitz in der Schweiz machten das Lesen des Romans manchmal ebenso schwierig wie seine augenfällige Neigung zu überzogener Fremdwörterei.
G: W. |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Peter Kurzeck:
Übers Eis
Mit großem Elan habe ich mit dem Lesen des Buches begonnen, schien mir doch vor allem anfangs die Sprache als etwas Besonderes. Aber dann bemerkt man immer schmerzlicher das vielfache Fehlen nicht nur der Verben, sondern auch von weiterem sprachlichen „Beiwerk“ in den Sätzen. Deshalb wurde für mich dieser „sms-Stil“ immer stärker zur Belastung und zum Suchspiel . Man fragt sich, ist die Sprache nur „Masche“, um sich von anderen Schreibern abzuheben, oder doch Ausdruck einer so gearteten Denkweise. Ich vermute, dass es keine bewusste Form der Abhebung zu anderen Schreibern ist, sondern Ausdruck seiner etwas stakkatohaften Denkweise. Üblicherweise wird gerade durch das Weglassen von Verben in Sätzen sprachlich Tempo aufgenommen. Aber nicht so bei Kurzeck. Er beschreibt an vielen Stellen immer und immer wieder dieselben Vorkommnisse, z.B. an kurz aufeinanderfolgenden Seiten - insgesamt auf einer ganzen Buchseite - wo überall Schnee liegen kann; mein Gott, mir wären noch hunderte anderer Orte eingefallen. Man mag das als detailgetreue und minutiöse Beschreibung feiern, für mich erzeugt diese Art der Erzählung lediglich ermüdende Langeweile. Durchaus gelungene, z.T. berührende, sehr ironische und komische Passagen traten beim Lesen des Buches leider in den Hintergrund. Vielleicht erhöhte sich der Wert des Buches durch eine radikale Kürzung des Textes?
G: W. |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
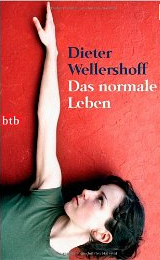 |
 |
Dieter Wellershoff
Das normale Leben
btb
Dieter Wellershoff erzählt in einer ruhigen, sauber durchformulierten Sprache. Dass kein PC-Bildschirm flimmert und nicht ständig ein Handy zwitschert, dass sich die handelnden Personen kultiviert ausdrücken und dass man sich beim Lesen nicht lachend auf die Schenkel klopft, ist durchaus kein Mangel. Zwar mögen die beschriebenen Paarbeziehungen nicht durchweg dem Zeitgeist entsprechen, dennoch gibt es sie. Vermutlich öfter, als mancher, der derartigen Charakterisierungen den Stempel „klischeebehaftet“ oder „spießig“ aufdrückt, sich selbst eingestehen mag. Der Autor konzentriert sich bewusst auf diese (spießigen?) Lebensformen und er beschreibt sie in der ihm eigenen, tiefgründig-philosophischen Erzählweise. In den vorliegenden zehn Geschichten, die kürzeste 4, die längste 72 Seiten lang, beleuchtet Wellershoff „Das normale Leben“ immer in einer bestimmten Phase des Seins. Dabei kann es sich um einen kurzen Moment des aneinander Vorbeigehens handeln, dann wieder um einen, Jahrzehnte überspannenden Lebensabschnitt. Allesamt sind es keine unerhörten Begebenheiten, die da vor einem aufgeblättert werden. Es sind raffiniert erzählte Alltagsgeschichten von Menschen, die im Verlauf ihres Lebens die eine oder andere Blessur davongetragen haben, daran aber nicht zerbrechen. Dafür gibt es von mir vier Federn.
H.S. |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
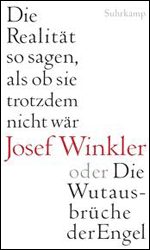 |
 |
| Josef Winkler
Die Realität so sagen, als ob sie trotzdem nicht wär oder
Die Wutausbrüche der Engel
Suhrkamp
Der Leser, der beweisen will, dass autobiografisches Schreiben nicht nur aus inhaltlich genauer Wiedergabe von Erinnerungen besteht, kann sich auf den Text von Josef Winkler berufen. Der schmale Band beeindruckt durch die atmosphärische Dichte, mit der der Autor die prägenden Erfahrungen seiner Kindheit und Jugend in einem Dorf in Kärnten schildert. Die Kraft seiner bildhaften Sprache lässt beim Leser tiefe, beklemmende Eindrücke zurück, die durchaus polarisieren können. Denn Winkler scheut sich nicht, das Doppelgesicht von vermeintlich fürsorgerischen Institutionen wie Familie, Dorfgemeinschaft und Kirche zu entlarven. Er schildert, wie dörfliche Enge, Druck und Gewalt zur Zerstörung von Leben führen. Aus dieser Gefahr, so macht er glaubhaft, kann sich der Einzelne nur retten, wenn er den Mut hat, die Rolle des diffamierten Außenseiters zu übernehmen. Die Kraft dafür findet Winkler in der Hinwendung zu Kunst und Literatur. Es mag eine Schwäche des Textes sein, dass die Darstellung der Biografien der Vorbilder des Autors, des Dichters J. Genet und des Malers Ch. Soutine, stilistisch nicht an die Anschaulichkeit und Eindrücklichkeit des übrigen Textes heranreichen. Dass der Autor in beiden Künstlern Bezugsgrößen für seine eigene literarische Arbeit gefunden hat, lässt sich jedoch gut nachvollziehen.
S.H.
|
 |
| |
Solange Winkler über seine eigene Jugend und Situation in der Enge des ländlichen Lebens schreibt, bleiben der Inhalt und die Sprache stark, obwohl alles Geschriebene schon in anderen Büchern des Autors zu großen Teilen abgehandelt wird. Die literarische Wiederholung schmälert den Wert des Buches. Richtig ärgerlich aber sind die Abhandlungen über seine (vermeintlichen?) Vorbilder Genet und Soutine. Da wird die Sprache schwach und das Geschriebene rückt an die Qualität eines Artikels bei Wikipedia, ist nur viel länger und an der Stelle in dem Buch m.E. völlig fehl am Platz. Insgesamt „ein Winkler“, den man gut missen kann.
G: W:

|
 |
 |
 |
 |
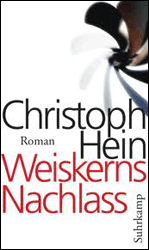 |
|
| Christoph
Hein
Weiskerns Nachlass
Suhrkamp
Der Stil ist sehr geradeaus und unspektakulär.
Es gibt weder bildmächtige noch elegante oder raffinierte
Formulierungen.
Das Leitthema kommt nur hin und wieder zum Tragen,
entwickelt sich aber im Verlauf des Romans nicht. Nach
einer kurzen Einführung zu Weißkern und der
Hauptfigur, was sie tut oder macht oder machen möchte,
nämlich eine Gesamtausgabe von Weißkerns
Schriften herausgeben, geht es um vieles Andere, was
lose aufgereiht ist. Es gibt eine kurze Sequenz bei
einem Verleger und dann noch eine bei der Familie eines
Studenten und natürlich noch die Situationen des
Angebotes gefälschter Autographen. Aber für
318 Seiten ist mir das zu dünn. Der Autor beschreibt
keine Hintergründe. Er hinterfragt nichts. Immer
wenn es dagegen handlungsbezogen wird, wird auch eine
gewisse Spannung aufgebaut:
Zum Ende hin, als er glaubt, seine Freundin noch einmal
für sich interessieren zu können, oder die
Hoffnung hat, an dem Studenten vorbei zu dem Archiv
des Onkels vorzudringen, als er wissen möchte,
wie die Sache mit der Fälschung ausgegangen ist,
und als nicht klar ist, wie seine Arbeitssituation sich
weiter entwickeln wird, da passiert nichts mehr. Das
Buch ist einfach aus.
Der Text auf dem Buchrücken erweckt inhaltliche
Erwartungen, die aber in keinem Punkt erfüllt werden.
Eigentlich ist es ein melancholisches Buch über
Idealismus und Lebensenttäuschungen, aber auch
darüber wird letztlich zu wenig erzählt.
Mein Fazit: ein wenig interessantes Buch!
TH
|
 |
| |
|
 |
 |
 |
 |
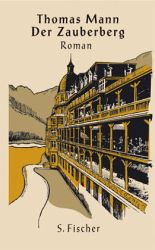 |
|
| Thomas Manns
Roman
Der Zauberberg
Fischer
(1913 begonnen, 1919 überarbeitet und fortgesetzt,
1924 beendet)
In seinem Vorwort zum „Zauberberg“, doppelsinnig
„Vorsatz“ genannt, bereitet Th. Mann den
Leser auf das vor, was ihn bei der Lektüre des
Werkes erwartet. Er wird den Roman mit Muße und
ohne Eile lesen müssen, denn der Unterhaltungswert
beruht nach Aussage des Autors auf der Gründlichkeit,
mit der die Geschichte der Hauptfigur Hans Castorp erzählt
wird. Auch habe der Leser keinen wirklich realistischen
Roman vor sich, obwohl dieser die Zeit „vor dem
großen Kriege“ spiegele, einer Epoche, die
„Leben und Bewußtsein“ der Zeitgenossen
durch eine „tief zerklüftende Wende“
beeinflusst habe. Th. Mann verweist auf die märchenhaften
Züge der Erzählung und deutet damit auf das
Wesen der Überzeitlichkeit hin, die dem Roman dauernde
Wirkung verleihen soll. So eingeführt, verfolgt
der Leser die siebenjährige Entwicklung des „Helden“,
die dieser nach dem Abschied vom tätigen Leben
im „Flachland“ in der dünnen Luft hoch
über Davos durchläuft. Im luxuriösen
Lungensanatorium „Berghof“ gibt er seinen
Vorsatz auf, Schiffsbauingenieur zu werden, und widmet
sich natur- und geisteswissenschaftlichen Studien. Angetrieben
wird er dabei von seinen beiden pädagogischen Mentoren,
die ihn in die philosophischen Ideen der Zeit einführen
und ihm die Einsicht in die scharfen Kontraste zwischen
Humanismus und bürgerlichem Fortschrittsglauben
und mittelalterlich reaktionärem Weltbild vermitteln.
Der Leser kann hier nicht nur zum Mitlernenden und Genießer
der geschliffenen Dialoge der Kontrahenten werden, sondern
in Identifikation mit Hans Castorp wird er auch dessen
allmähliche Distanzierung von beiden Extrempositionen
verstehen. Er kann den Reifeprozess mitvollziehen, der
den „Helden“ von seiner in ihm angelegten
Sympathie mit Krankheit und Tod zu einer lebensbejahenden
Einstellung führt und ihn das Leiden als einen
Teil des Lebens anerkennen lässt. Anregend sind
auch die Reflexionen über den Doppelcharakter der
Zeit, über das Wesen der Musik und über die
Liebe, mit der Hans Castorp in der besonderen Atmosphäre
des Sanatoriums bekannt wird. Die anschauliche, detailreiche
Schilderung der besonderen, hermetisch geschlossenen
Welt ist es auch, die den Leser vor Langeweile bewahrt.
Th. Mann stellt, ironisch überspitzend, eine Anzahl
skurriler Charaktere so lebendig dar, dass sie mit Sicherheit
im Gedächtnis haften bleiben.
Wer also keine Berührungsangst vor dickleibiger
Lektüre hat und Denkanstöße zu den Roman
betreffenden biografischen, philosophischen, historischen
und/oder musikwissenschaftlichen Themen sucht, sollte
sich ruhig Zeit nehmen und sich von Th. Manns Roman
verzaubern lassen!
S. H. |
 |
| |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
| Bascha Mika
- Die Feigheit der Frauen
„ Die Feigheit der Frauen“ wird auf ein
paar Feldern beschrieben, ohne dass sie im Einzelnen
wirklich unterschiedlich sind. Die Darstellung enthält
Wiederholungen und Ausschmückungen des immer wieder
selben Tatbestandes, nämlich dass sich Frauen –
z.T. auch sehr gern – den Männern finanziell
ausliefern und damit auf vielen Feldern von ihnen abhängig
sind. B.M. nennt das Hormonfalle oder Komfortzone. Die
Lösung des Problems, wie Frauen daraus entfliehen
oder sie vermeiden können, bleibt B.M. weitgehend
schuldig. Einzig und allein wird der Lebensentwurf vieler
Frauen, Hausfrau und Mutter zu sein, als einengend,
stumpf und abhängig machend beschrieben. Arbeiten
Frauen hingegen, wären sie frei, stünden auch
in geistigem Wettbewerb und es ginge ihnen besser. Das
alles sind Klischees, die B.M. nur zu gerne und gebetsmühlenhaft
wiederholend bedient. Ein Buch, das man nicht lesen
muss, der Klappentext reicht wirklich völlig.
G. W. |
 |
| |
|
 |
 |
 |
 |
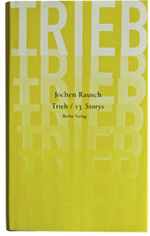 |
 |
| Trieb / 13
Storys, Jochen Rausch
Berlin Verlag
"Menschen tun manchmal sehr krasse Dinge."
ist auf der Rückseite von Jochen Rauschs Trieb
/ 13 Storys zu lesen. Diese krassen Dinge hat Rausch
13 mal sehr genau unter die Lupe genommen. 13 mal geht
es um den Tod, und um die Konflikte und Dramen davor.
Die literarische Darreichung ist zweifelsfrei über
200 Seiten gelungen. Rausch morpht Umstände und
Akteure eindrucksvoll zum Showdown. Schon in der ersten
Story ist die Erzählstruktur so elegant angelegt,
das man beim Lesen den Protagonisten durchs Atmen wahrnimmt
und Schuppen aufs Jacket fallen hört. Das funktioniert
deswegen, weil Jochen Rausch schreiben kann und seine
Geschichten fesseln. Ach, wären Kurzgeschichten
doch immer so. Manchmal zu detailverliebt, so dass man
in manchen Kapiteln schwer eigene Bilder entwerfen kann
und sich statt dessen als Getriebener vermeintlich realer
Gerichtsreportagen fühlt.
"Sie ist sicher, dass er sie zum Abschied küssen
wird. Wahrscheinlich erst, wenn das Taxi kommt, das
ihn zum Flughafen fährt. Wenn er sie nicht küsst,
wird sie es tun." Sie wird ihn am Ende natürlich
nicht küssen. So viel kann man schon verraten.
Weil das Ende viel aufregender ist.
W.D.
. |
 |
| |
|
 |
 |
 |
 |
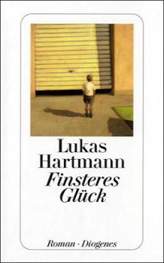 |
 |
| Finsteres
Glück, Lukas Hartmann
Diogenes
Diese Geschichte hätte als Thriller, Psychodrama
oder sogar als Jugendbuch geschrieben werden können.
Zutaten für jedes dieser Genres waren enthalten.
Gelesen habe ich aber nur einen gut formulierten Fall
eines Familiendramas mit gutem Ende für einen traumatisierten
Jungen. Vielleicht sogar für Frau mit Ex und ihren
Töchtern. Bei diesem handlungsbezogenen Roman fehlten
mir der Pfeffer (die Konflikte), die ein gerades Voranschreiten
der Handlung verhinderten. Alle beschriebenen Konflikte
lösten sich ohne besonderes Zutun von selbst.
Die beiden Töchter maulten oder zickten, verhielten
sich aber im entscheidenden Augenblick vorbildlich.
Die Familie der Schwester versuchte alles Unmögliche,
konnten aber nicht verhindern, dass der Junge zuletzt
der Psychologin geradezu angedient wurde „…
Sie können ihn haben.“ Die Psychologin ist
überbeansprucht. Genießt aber am Ende ohne
besondere eigene Leistung den Kopf des Jungen an ihrer
Schulter. Dazu findet eine Annäherung an ihren
Ex statt und die gebeutelte Großmutter schreibt
sich von ihren Seelenqualen frei und zaubert auch noch
eine Pistole hervor, die, gefährlich wie so ein
Ding ist, hier aber keine weitere Rolle spielt. Selbst
die Beichte des Jungen, er selbst hätte den Unfall
verursacht, konnte wie alles andere im Voraus erahnt
werden. Dass nicht stattdessen ein offenes Ende das
Buch beschließt, lag vielleicht an dem gewünschten
Therapieerfolg der Protagonistin, ist der Autor doch
vom Fach.
Einen besonderen Rang hatte in dem Buch der Isenheimer
Altar. Die Beschreibung wurde als besonders anschaulich
empfunden. Dessen Bedeutung für den Verlauf der
Handlung unklar bleibt.
TH
. |
 |
| |
|
 |
 |
 |
 |
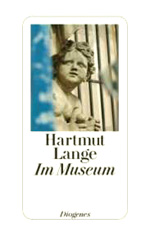 |
 |
| Im Museum,
Hartmut Lange
Diogenes
In dem schmalen, 114 Seiten umfassenden Büchlein,
hat Autor Hartmut Lange Kurzgeschichten vereinigt, die
allesamt im Deutschen Historischen Museum in Berlin
spielen.
Seltsame Dinge geschehen dort, insbesondere des Nachts,
wenn der zahlende Besucher das Haus längst verlassen
hat. Adolf Hitler oder das vergleichsweise unbedeutende
Monster, Stasileutnant Klinger, treten dann als Geistwesen
heraus aus den Schatten der musealen Exponate, die an
die von den Untoten begangenen Verbrechen erinnern.
Aber auch die Verkörperung des einsamen Menschen,
hier in Gestalt einer verschwundenen Museumsangestellten,
zeugen von der unabänderlichen Vergänglichkeit
des Seiens.
Der tiefere Sinn der Geschichten erschließt sich
kaum beim oberflächlichen Lesen, er verbirgt sich
eher im Subtext, beziehungsweise blitzt allenthalben
zwischen den Zeilen hervor. Man sollte den Inhalt des
Büchleins deshalb in kleinen, homöopathischen
Dosen auf sich einwirken lassen. Nicht zuletzt um der
Gefahr vorzubeugen, dass allzu viele Geister, in kürzester
Zeit genossen, einem dann doch schnell überdrüssig
werden können.
H.S.
. |
 |
| |
|
 |
|
|
| |
|
|